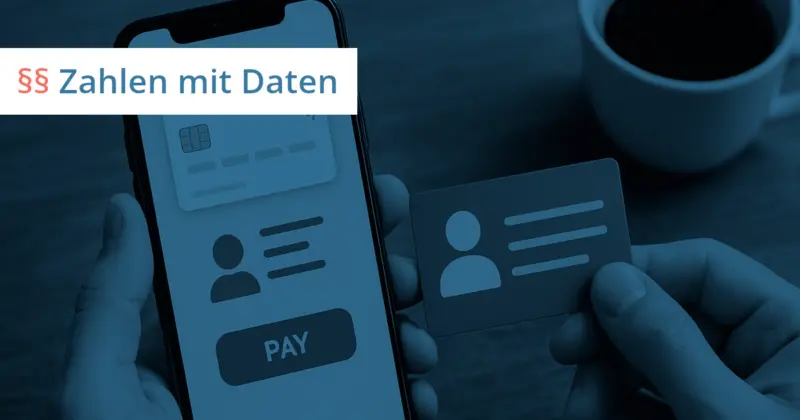
Viele Unternehmen werben heute mit „kostenlosen“ digitalen Angeboten, bei denen Nutzer statt Geld ihre Daten zur Verfügung stellen. Doch ist solche Werbung bei Bezahlung mit Daten erlaubt?

Rechtsanwalt Niklas Plutte
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Rechtsanwalt Oliver Wolf, LL.M.
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Benötigen Sie rechtliche Beratung im IT-Recht und Werberecht? Nutzen Sie unsere kostenlose Ersteinschätzung.
Inhaltsübersicht
1. Ist etwas „kostenlos“, wenn man mit seinen Daten zahlt?
2. OLG Stuttgart: „Kostenlose“ Lidl Plus App
3. Kammergericht: „Facebook ist und bleibt kostenlos“
4. BGH-Vorlage an EuGH
5. Rechtliche Einordnung & Ausblick
1. Ist etwas „kostenlos“, wenn man mit seinen Daten zahlt?
Mit dem Siegeszug digitaler Geschäftsmodelle hat sich der Wertschöpfungsprozess von klassischen Geldzahlungen hin zu Datentransaktionen verändert. Zahllose Dienste, die man heute „umsonst“ nutzen kann, finanzieren sich durch Werbung, Datenauswertung und natürlich auch die Weitergabe von Nutzerdaten an Dritte, die berühmt-berüchtigten „Partner“.
Beworben werden solchen Dienste dann mit Claims wie „kostenlos“ oder „gratis“. Tatsächlich verlangen die Anbieter von Ihren Nutzern auch keine Geldzahlung. Das bedeutet jedoch nicht, dass keinerlei Gegenleistung erbracht würde. Denn im Gegenzug für die Nutzung des Dienstes (z.B. App, Spiel, Tool etc.) verlangen die Anbieter weitreichenden Zugriff auf die personenbezogenen Daten ihrer Nutzer.
Manchmal wird dieses Tauschgeschäft im Internet offen und transparent abgewickelt. In den meisten Fällen verlieren die Anbieter aber kaum Worte, wie tiefgreifend der Zugriff auf die Nutzerdaten ausfällt. Gleichzeitig ist fraglich, ob Verbrauchern die Reichweite und Auswirkung solcher Tauschgeschäfte klar ist.
Damit drängt sich die Frage auf, ob „Kostenlos“-Werbung bei Bezahlung mit Daten in Konflikt mit dem Verbraucherrecht bzw. Wettbewerbsrecht steht.
Juristisch stehen drei Regelungsbereiche im Spannungsverhältnis:
- Verbraucherrecht / Preisangabenpflichten: Welche Pflichten bestehen, wenn eine Leistung „kostenlos“ angeboten wird? Müssen Preise angegeben werden? (§§ 312d, 312e BGB, Art. 246a EGBGB)
- Irreführungsrecht / UWG: Ist eine „Kostenlos“-Werbung objektiv irreführend und damit wettbewerbswidrig, wenn die Nutzer ihre Daten preisgeben müssen? (§§ 5, 5a UWG, Nr. 20 der Anlage zu § 3 UWG)
- Datenschutzrecht / DSGVO: Welche Transparenzpflichten bestehen bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 13, 14 DSGVO)? Können die Informationspflichten der DSGVO in Konflikt mit Verbraucherrechtspflichten stehen?
Hinweis: In diesem Beitrag stellen wir Urteile zur Thematik dar, u.a. das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 23.09.2025 (6 UKl 2/25) zur Lidl Plus App sowie Rechtsprechung der Berliner Gerichte zur Werbung „Facebook ist und bleibt kostenlos“. Bei künftigen neuen Entscheidungen werden wir den Beitrag aktualisieren.
2. OLG Stuttgart: „Kostenlose“ Lidl Plus App
Der Discounter Lidl betreibt mit der Lidl Plus App ein Treue- / Bonusprogramm, für das sich Nutzer registrieren können. Die App wird als „kostenlos“ bzw. „gratis“ beworben. Sie muss nicht mit Geld bezahlt werden. Um sie nutzen zu können, müssen Nutzer aber im Rahmen der Registrierung personenbezogene Daten preisgeben.
Hieran störte sich der Verbraucherzentrale Bundesverband. Lidl solle aufhören zu behaupten, man könne die App kostenlos nutzen. Außerdem solle der Discounter den Gesamtpreis angeben. Der Begriff „kostenlos“ sei im Kontext der App-Werbung missverständlich und irreführend, da Nutzer letztlich mit ihren Daten bezahlen würden.
Auf Klage des vzbv entschied das OLG Stuttgart jedoch zugunsten von Lidl (OLG Stuttgart, Urteil vom 23.09.2025, Az. 6 UKl 2/25). Das Gericht sah kein Verstoß gegen Verbraucherschutzgesetze. Daher bestehe weder ein Unterlassungsanspruch nach § 2 Abs. 1 UKlaG noch ein Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten (§ 5 UKlaG i.V.m. § 13 Abs. 3 UWG).
- Der Senat stellt zunächst klar, dass der Begriff des Preises im Sinne von § 312d Abs. 1 S. 1 BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB ausschließlich eine Geldleistung erfasst. Maßgeblich sei eine richtlinienkonforme Auslegung nach Art. 6 Abs. 1 lit. e der Verbraucherrechterichtlinie (2011/83/EU) und Art. 2 Nr. 7 der Richtlinie (EU) 2019/770. Beide Regelwerke knüpfen an finanzielle Gegenleistungen oder digitale Wertdarstellungen an, nicht aber an die bloße Bereitstellung personenbezogener Daten. Mit anderen Worten: Wer Daten angibt, zahlt keinen „Preis“ im rechtlichen Sinn. Eine Pflicht zur Preisangabe nach § 312d BGB i.V.m. Art. 246a EGBGB bestehe daher nicht, wenn Nutzer lediglich Daten übermitteln.
- Im zweiten Schritt betont das Gericht, dass Fragen der Datentransparenz nicht dem Preisangabenrecht, sondern dem Datenschutzrecht zugeordnet sind. Die Informationspflichten über Zweck, Umfang und Empfänger der Verarbeitung ergebe sich vollständig aus Art. 13 und 14 DSGVO. Diese Vorschriften deckten genau den Informationsbedarf ab, den man andernfalls über Preisangaben regeln wollte – etwa welche Daten wofür erhoben, an wen sie übermittelt und wie lange sie gespeichert werden. Das Preisrecht sei für solche Transparenzfragen schlicht nicht das richtige Regime.
- Anschließend befasst sich das OLG Stuttgart mit der Frage, ob die Bezeichnung „kostenlos“ irreführend sein kann. Der Senat verneint dies: Die Verwendung des Begriffs sei nicht per se unzulässig. Sie bleibe erlaubt, solange keine monetären Kosten entstehen, die Datenerhebung und -verwendung klar und angemessen erläutert werden und kein Nutzer tatsächlich Geld zahlen muss. Unter diesen Voraussetzungen liege weder ein Verstoß gegen Nr. 20 der Anlage zu § 3 Abs. 3 UWG noch gegen §§ 5, 5a UWG vor.
- Die Anwendbarkeit der §§ 312 ff. BGB ließ das Gericht offen. Selbst wenn man – etwa aufgrund von § 312 Abs. 1a BGB – von einer entsprechenden Anwendung auf Verträge mit Datenbereitstellung ausgehen wollte, ergäbe sich kein anderes Ergebnis: Ohne Geldpreis bestehe auch keine Pflicht zur Preisangabe.
- Zugleich lässt der Senat die Revision zum BGH zu, weil die aufgeworfenen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung seien. Das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig.
Kurzzusammenfassung: Anbieter dürfen nach Auffassung des OLG Stuttgart mit „kostenlos“ werben, wenn keine Geldzahlung verlangt wird, die Datenerhebung transparent und DSGVO-konform dargestellt ist und keine versteckten oder verschleierten Kosten existieren.
3. Kammergericht: „Facebook ist und bleibt kostenlos“
Bereits 2018 und 2019 hatten sich die Berliner Gerichte mit dem Claim „Facebook ist und bleibt kostenlos“ befasst (LG Berlin, Urteil vom 16.01.2018, Az. 16 O 341/15; Kammergericht, Urteil vom 20.12.2019, Az. 5 U 9/18).
Ebenso wie das OLG Stuttgart kamen beide zu dem Ergebnis, dass der Claim nicht irreführend sei, weil keine Geldzahlung anfiel. Die Bereitstellung personenbezogener Daten sei keine entgeltliche Leistung im Sinne des UWG. Das Gericht stellte zwar an anderer Stelle Datenschutz-/AGB-Verstöße von Facebook fest. Die Aussage „kostenlos“ beziehe sich aber auf eine monetäre Dimension und sei zulässig, solange der Nutzer kein Geld zahle. Transparenz über den Umfang der Nutzung personenbezogener Daten sei Sache des Datenschutzrechts, nicht des Preisangabenrechts.
4. BGH-Vorlage an EuGH
Der Bundesgerichtshof hat den EuGH im obigen Facebook-Prozess um Vorabentscheidung gebeten, ob der Begriff der „Kosten“ im Sinne von Nr. 20 des Anhangs I in Verbindung mit Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2005/29/EG auch die Preisgabe personenbezogener Daten und Einwilligung in ihre Nutzung zu kommerziellen Zwecken erfasst (BGH, Beschluss vom 25.09.2025, Az. I ZR 11/20 – Kostenlose Registrierung).
5. Rechtliche Einordnung & Ausblick
Das OLG Stuttgart stärkt die Rechtssicherheit datenbasierter Geschäftsmodelle und liefert eine belastbare dogmatische Basis: „Preis“ im Verbraucherrecht meine Geld. Was die Transparenz über Datenverarbeitung betrifft, sei die DSGVO das einschlägige Regime. Es wird sich zeigen, ob die zu erwartende Revision im Stuttgarter Verfahren sogar von der Vorlageentscheidung des EuGH überholt wird. Sollte der EuGH (und hieran anknüpfend der BGH) die Stuttgarter Linie bestätigen, wäre das wichtig für Pay-with-Data-Modelle, Pay-or-Consent-Ansätze und Ad-finanzierte Plattformen.
Tipp: Beachten Sie unseren ausführlichen Beitrag zu rechtssicherer Preiswerbung mit 20+ Werbeformen im Rechts-Check sowie unsere FAQ zur Preisangabenverordnung.
