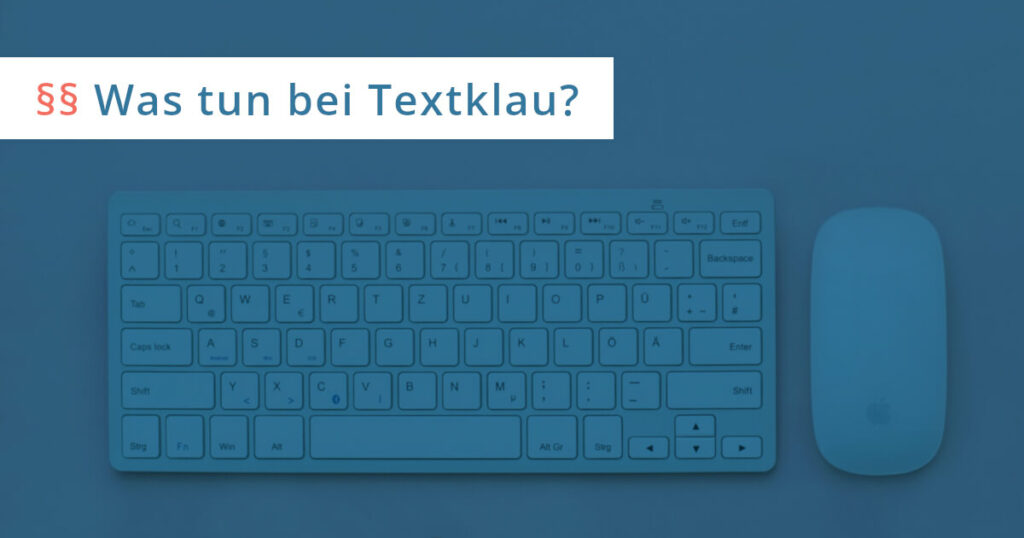Im Internet kommt die ungefragte Übernahme von Texten häufig vor. Urheber müssen das nicht hinnehmen. Wir erklären in diesem Artikel, wann ein Text rechtlich geschützt ist, wie man Textübernahmen ermittelt und seine Urheberschaft beweist sowie welche Ansprüche gegen den Verletzer bestehen.
Rechtsanwalt Niklas Plutte
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
Rechtsanwalt Oliver Wolf, LL.M.
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
Wir sind erfahrene Rechtsanwälte für Urheberrecht. Nutzen Sie unsere kostenfreie Erstberatung.
Inhaltsübersicht
1. Wann ist ein Text urheberrechtlich geschützt?
2. Wie beweist man seine Urheberschaft?
3. Warum ist die Übernahme von Text durch Dritte nachteilig?
4. Wie ermittelt man einen Diebstahl von Texten?
5. Wie schützt man sich gegen Textklau?
6. Empfehlungen zur Beweissicherung
7. Und jetzt? Was tun bei Textklau?
1. Wann ist ein Text urheberrechtlich geschützt?
Bevor man sich mit Ansprüchen gegen den Verletzer beschäftigt, stellt sich im ersten Schritt die Frage, ob der übernommene Text als Sprachwerk bzw. Schriftwerk nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UrhG geschützt ist. Das ist nur der Fall, wenn der Text ausreichende Schöpfungshöhe aufweist.
Ausreichende Schöpfungshöhe liegt vor, wenn der Text eine „persönliche geistige Schöpfung“ darstellt (§ 2 Abs. 2 UrhG). Die schöpferische Leistung kann bei Texten sowohl in der individuellen sprachlichen Gestaltung als auch in der Sammlung, Auswahl, Einteilung und Anordnung des Stoffes liegen. Bei Schriftwerken ist die Schutzgrenze niedrig anzusetzen (sog. „kleine Münze“ des Urheberrechts). Schöpfungshöhe eines Sprachwerkes ist im Grundsatz unabhängig davon, ob der zu beurteilende Text journalistischen, wissenschaftlichen, schöngeistigen oder sonstigen Inhalts ist (LG München, Urteil vom 31.01.2022, Az. 21 O 14450/17).
Frei erfundene Sprachwerke erhalten leichter Urheberrechtsschutz als Texte, bei denen der Stoff durch organisatorische Zwecke oder wissenschaftliche und andere Themen vorgegeben ist, da diesen durch die übliche Ausdrucksweise vielfach die urheberrechtschutzfähige eigenschöpferische Prägung fehlt (LG Stuttgart, Urteil vom 04.11.2010, Az. 17 O 525/20). Solche Texte können aber aufgrund eigenschöpferischer Gedankenformung und -führung des dargestellten Inhalts und/oder der besonders geistvollen Form und Art der Sammlung, Einteilung und Anordnung des dargebotenen Stoffs schutzfähig sein (BGH, Urteil vom 29.03.1984, Az. I ZR 32/82 – Ausschreibungsunterlagen).
Werbeslogans oder Werbetexte müssen über die üblichen Anpreisungen hinausgehen, um Urheberrechtsschutz zu erlangen. Die Urheberrechtsschutzfähigkeit erfordert bei Gebrauchszwecken dienendem Schriftgut grundsätzlich ein deutliches Überragen des Alltäglichen, des Handwerksmäßigen, der mechanisch-technischen Aneinanderreihung des Materials (BGH Urteil vom 10.10.1991, Az. I ZR 147/89 – Bedienungsanweisung). Gebrauchstexte, deren Formulierungen zwar in ihrer Art und Weise ansprechend sind, aber sich ansonsten durch nichts von den üblicherweise in Modekatalogen und Bestellprospekten von Versandhäusern verwendeten Beschreibungen unterscheidet, genießen keinen urheberrechtlichen Schutz (LG Stuttgart, Urteil vom 04.11.2010, Az. 17 O 525/20). Je länger ein Text, desto größer die Gestaltungsmöglichkeiten, so dass umso eher eine hinreichende eigenschöpferische Prägung anzuerkennen ist (OLG Köln, Urteil vom 30.09.2011, Az. 6 U 82/11).
Beispiele:
- Bei literarischen Werken wie einem Roman liegt im Ergebnis immer Schöpfungshöhe vor.
- Bei Gebrauchstexten (speziell Werbetexten) reichen ansprechende Formulierungen reichen nicht aus, wenn sie sich nicht von üblicherweise verwendeten werbenden Beschreibungen unterscheiden (abgelehnt in: LG Frankenthal, Urteil vom 03.11.2020, Az. 6 O 102/20 für eBay Kleinanzeigen Werbetext). Derartige Werbetexte sind faktisch gemeinfrei.
- Sehr kurze Texte genießen aufgrund ihrer Kürze meist keinen Urheberrechtsschutz. So wurde dem Satz „Früher war mehr Lametta“ aus einem bekannten Loriot-Sketch Urheberrechtsschutz abgesprochen (OLG München, Beschluss vom 14.08.2019, Az. 6 W 927/19). Abweichend hiervon stufte das Oberlandesgericht Hamburg die Schlagzeile „Wir sind Papst“ Schutz als Sprachwerk ein, obwohl es sich nur um einen Drei-Wort-Satz handelt (OLG Hamburg, Urteil vom 29.08.2024, Az. 5 U 116/23 – Wir sind Papst). Wir gehen aktuell davon aus, dass es sich um eine Einzelfallentscheidung handelt, aus der keine Absenkung der Anforderungen an die Schöpfungshöhe von Texten abgeleitet werden sollte.
- Bei Rechtstexten wie zum Beispiel Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann die individuelle Auswahl der einzelnen Klauseln, deren Anordnung und Formulierung zu Urheberrechtsschutz führen (vgl. AG Kassel, Urteil vom 05.02.2015, Az. 410 C 5684/13; AG Köln, Urteil vom 08.08.2013, Az. 137 C 568/12; OLG Köln, Urteil vom 27.02.2009, Az. 6 U 193/08).
Die Frage der Schutzfähigkeit stellt sich im Besonderen, wenn nur Teile eines geschützten Textes übernommen wurden. Weitergehende Infos zur Schutzfähigkeit von Texten speziell für Autoren habe ich bei Textbroker verfasst.
Bei Veröffentlichung leicht veränderter Texte ist zu klären, ob es sich bei dem veränderten Text um eine Bearbeitung (§ 23 UrhG) oder eine freie Benutzung (§ 24 UrhG) handelt. Eine Bearbeitung ist nur erlaubt mit Einwilligung des Urhebers, eine freie Benutzung auch ohne seine Zustimmung.
Tipp: Da Urheberrechte an Texten im Gegensatz zu Marken oder Patenten nicht durch Eintragung in Register oder andere formelle Akte entstehen, sondern allein durch Erstellung des Textes, verbleiben in der Praxis oft Unsicherheiten, ob der jeweilige Text Schöpfungshöhe aufweist. Urheber sollten sich davon jedoch nicht abschrecken lassen, sondern eine professionelle individuelle Einschätzung einholen.
PS. Hat ein Mitbewerber den eigenen (Werbe-)Text übernommen, können im Einzelfall auch Ansprüche aus Wettbewerbsrecht bestehen (§ 8 Abs. 1 UWG i.V.m. §§ 3, 4 Nr. 3 UWG). Dies ist aber eher die Ausnahme.
Sind die Parteien Mitbewerber, kann der Text im Einzelfall auch unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wettbewerbsrechtlich geschützt sein. Meist wird es in der Praxis aber an der nötigen wettbewerblichen Eigenart des Textes scheitern (vgl. LG Frankenthal, Urteil vom 03.11.2020, Az. 6 O 102/20).
2. Wie beweist man seine Urheberschaft?
Praktisch besonders relevant ist in Textklau-Fällen der Nachweis der eigenen Urheberschaft. Verfügt der Text über einen Urhebervermerk, wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, dass der dort Genannte Urheber des Textes ist (§ 10 UrhG). Findet sich ein ©-Vermerk im Rahmen einer Internetseite, erstreckt sich dieser auch auf das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Nach § 10 UrhG besteht kein Erfordernis, den ©-Vermerk mit einem Rechtekatalog oder einem pauschalen Bezug wie „alle Rechte vorbehalten“ zu versehen; der Vermerk soll nach dem Gesetzeszweck eine Erleichterung im Rechtsverkehr bewirken und lebt deshalb von seiner Einfachheit und Klarheit (LG München, Urteil vom 31.01.2022, Az. 21 O 14450/17).
Gibt es keinen „Copyright-Vermerk“, muss der Urheber den vollen Beweis für seine Urheberschaft erbringen. Für den Nachweis eignen sich zum Beispiel Zeugen, aber auch Logdateien, datierte Ausdrucke des Textes oder Way-Back-Maschinen.
Screenshot meiner Website vom 29.01.2014 mit einem Artikel über ein Münchner Impressums-Urteil (Impressum-Grafik: © so47 – Fotolia.com).
Achtung: Urheberrechtliche Unterlassungsansprüche können nur vom Inhaber der ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte am jeweiligen Text geltend gemacht werden. Hat man einen Text verfasst, der bewusst auf einer fremden Website veröffentlicht wurde (etwa als Gastartikel in einem befreundeten Blog), sollte man darauf achten, dass dem Websitebetreiber nur einfache Nutzungsrechte am Text eingeräumt werden, und das am besten schriftlich / per E-Mail oder sogar in einem formellen Lizenzvertrag. Erhält der Websitebetreiber dagegen ein Exklusivrecht für die Veröffentlichung des Textes (Stichwort „unique content“), kann der Urheber gegen Textklau durch fremde Dritte nicht mehr vorgehen.
3. Warum ist die Übernahme von Text durch Dritte nachteilig?
Textklau ist aus mehreren Gründen nachteilig. Der Urheber darf als Schöpfer des Textes schon von Gesetzes wegen allein bestimmen, ob und wo sein Text veröffentlicht wird. Dazu gehört das Recht, den Text wirtschaftlich zu verwerten. Im Internet kommt hinzu, dass Google einzigartigen Content schätzt. Doppelte Texte können Duplicate Content verursachen mit der Folge, dass der „berechtigte“ Text im organischen Google-Ranking an Bedeutung verliert.
4. Wie ermittelt man einen Diebstahl von Texten?
Im Internet findet man eine Reihe von Tools, mit deren Hilfe Textübernahmen auf einfache und oft kostenlose Weise ermittelt werden können. Der bekannteste Dienste ist Copyscape. Bei Eingabe der URL mit dem eigenen Text in den Suchschlitz ermittelt die Software binnen weniger Sekunden, ob und ggf. auf welchen anderen Webseiten der Text noch zu finden ist.
Alternativ kann man die exakte Suche bei Google nutzen, indem man den Text innerhalb von Anführungszeichen bei Google eingibt. Hier ein Beispiel für unseren Widerrufsbelehrung Generator, dessen Nutzung kostenlos ist, wenn im Gegenzug an der erzeugten Widerrufsbelehrung ein Hinweis auf unseren Generator samt Backlink angebracht wird.
5. Wie schützt man sich gegen Content-Klau?
Absoluten Schutz vor Textübernahmen gibt es nicht. Mithilfe von CSS und Javascript lässt sich Text zwar „unmarkierbar“ machen bzw. bei Markierungen + Rechtsklick ein Pop-Up öffnen, das auf die fehlende Kopierbarkeit hinweist. Das Schutzlevel ist allerdings begrenzt, da der Text weiterhin über eine Einsicht in den Quellcode der Webseite kopiert oder schlicht abgeschrieben werden kann.
6. Empfehlungen zur Beweissicherung
Hat der Urheber eine unerlaubte Übernahme seines Textes festgestellt, sollte er zunächst Beweise sichern, da Internetseiten bekanntlich jederzeit abgeändert werden können. Auf Screenshots sollte neben der Textübernahme auch das Datum und die Uhrzeit des Abgriffs festgehalten werden. Ich empfehle die Nutzung der atomshot Extension für den Chrome Browser, die von den Mainzer Kollegen bei GGR Law entwickelt wurde.
Insgesamt empfiehlt es sich, den Textklau auf verschiedene Weisen zu sichern. Möglich ist z.B. auch ein Abspeichern der gesamten Webseite (= URL, nicht Website!).
Und jetzt? Was tun bei Content-Klau?
1. Möglichkeit: Nichts tun
Niemand ist verpflichtet, gegen die Übernahme von Content vorzugehen. Wer Auseinandersetzungen scheut, kann die Seite bei Google unter dem Link https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport?hl=de&pli=1. denunzieren. Einfach in der Rubrik „Urheberrecht und andere rechtliche Probleme“ alle Fragen beantworten, dann beschäftigt sich die Suchmaschine mit der Gegenseite.
2. Möglichkeit: E-Mail an Websitebetreiber / Eigenabmahnung
Eine E-Mail an den fremden Websiteinhaber mit der Bitte um Entfernung des Textes ist ebenso möglich wie eine Eigenabmahnung. Letztere ist nicht risikolos, wenn der Urheber seine Ansprüche später durch einen Rechtsanwalt durchsetzen lassen will, falls keine freiwillige Löschung erfolgt.
3. Möglichkeit: Anwaltliche Abmahnung
Der Verletzer kann per Abmahnung zur Unterlassung aufgefordert werden. Der Urheber darf vom Verletzer die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangen, mit der sich der Verletzer verpflichten soll, den Text zu entfernen und künftig nicht wieder zu verwenden. Gibt der Urheber die geforderte Unterlassungserklärung ab, steht dem Urheber im Wiederholungsfall die Zahlung einer Vertragsstrafe zu, die meist mehrere Tausend Euro pro Fall beträgt. Für das Vorgehen gegen den Verletzer darf der Urheber unmittelbar einen Rechtsanwalt einschalten, dessen Kosten vom Verletzer zu ersetzen sind. Der Streitwert bei Werbetexten dürfte ähnlich wie bei der Verletzung von Fotorechten regelmäßig bei 5.000 – 6.000 Euro beginnen (vgl. LG Frankenthal, Urteil vom 03.11.2020, Az. 6 O 102/20).
Zusätzlich darf der Urheber wegen der Verletzung seiner Urheberrechte Schadensersatz verlangen. Der Höhe nach muss bezahlt werden, was ein vernünftigter Lizenzgeber bei vertraglicher Einräumung der Nutzungsrechte verlangt und ein vernünftiger Unternehmer gewährt hatte. Zur Berechnung des Schadensersatzes darf auf branchenübliche Vergütungssatze und Tarife zurückgegriffen werden. Die vom Deutschen Journalisten-Verband erstellte Übersicht über Vertragsbedingungen und Honorare für die Nutzung freier journalistischer Beitrage 2013 gehört dazu. Das Amtsgericht Hamburg sprach einem Anwaltskollegen auf dieser Basis zum Beispiel pro Textübernahme einen Betrag von je 200,00 € zu (AG Hamburg, Urteil vom 23.01.2015, Az. 35a C 46/14). Unter Umständen (z.B. bei absichtlicher Fälschung der Urheberschaft) steht dem Geschädigten nicht nur Schadenersatz, sondern darüber hinausgehend sogar Schmerzensgeld zu (OLG Frankfurt, Urteil vom 04.05.2004, Az. 11 U 6/02, 11 U 11/03).
Übrigens: Der Autor eines Onlineartikels kann bei unangemessen niedrigem Honorar nachträglich die Zahlung einer angemessenen Vergütung vom Verlag verlangen.
Nutzen Sie bei Textklau unsere kostenfreie Erstberatung. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei einer Abmahnung.